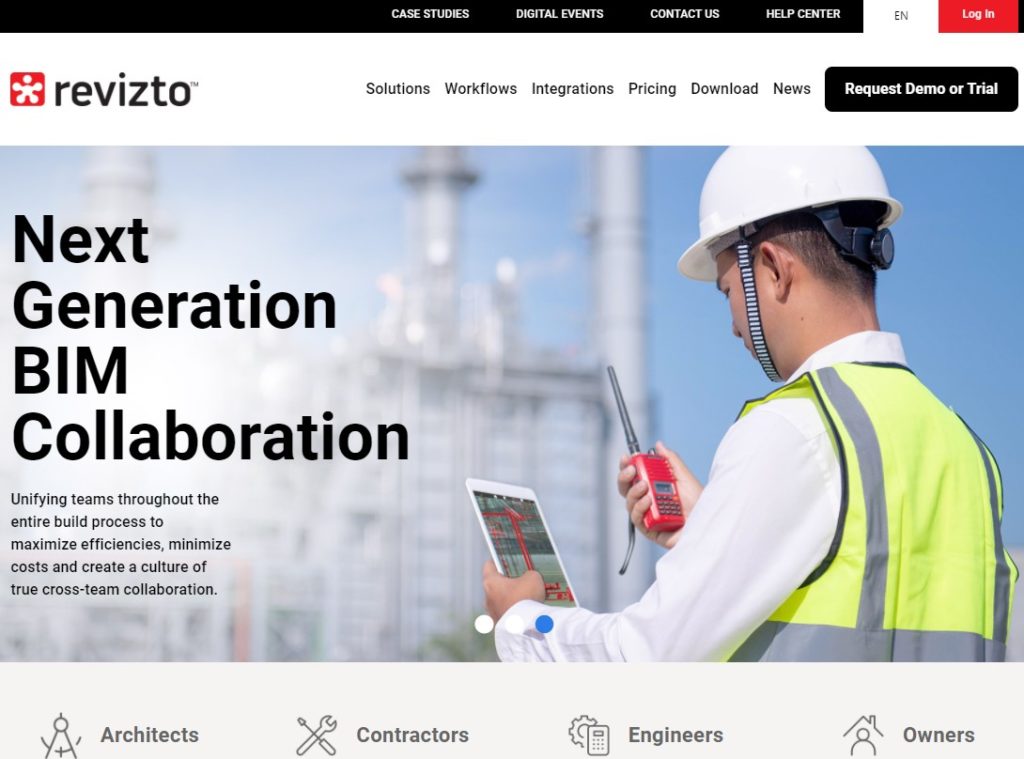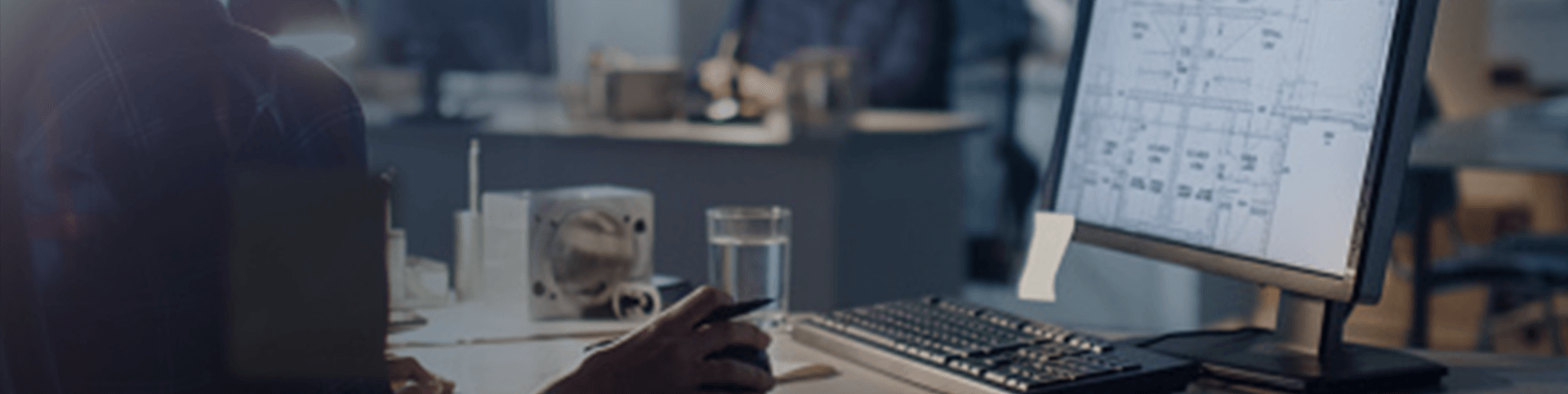BIM Workflows und Bauprojekte
- Was ist BIM-Einführung?
- Der BIM-Workflow und warum er so anders ist
- Was sind die wichtigsten Phasen eines BIM-Workflows?
- Was sind die Vorteile und Herausforderungen bei der Implementierung von BIM?
- Wie planen Sie die BIM-Ausführung für ein Projekt?
- Wie standardisieren Sie BIM-Arbeitsabläufe in Ihrem Unternehmen?
- Welche Software und Tools werden für BIM-Workflows benötigt?
- Was ist openBIM und warum ist Interoperabilität wichtig?
- Wie stellen Sie die Qualität und Genauigkeit eines BIM-Modells sicher?
- Was sind die zukünftigen Trends in der BIM-Technologie?
- Fazit
- Die wichtigsten Erkenntnisse
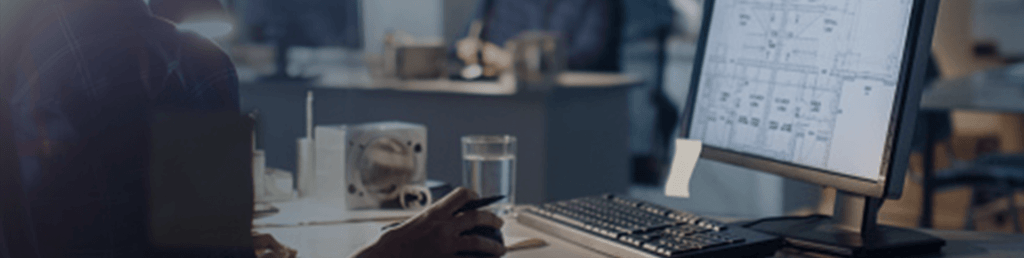
Die Modellierung von Gebäudedaten (Building Information Modeling, BIM) stellt einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise dar, wie Bauprojekte entworfen, koordiniert und geliefert werden. Dabei wird von isolierten 2D-Zeichnungen zu integrierten 3D-Modellen übergegangen, die mit Daten zu jeder Gebäudekomponente angereichert sind. BIM-Workflows verbinden Architekten, Ingenieure, Bauunternehmer und Bauherren durch gemeinsam genutzte digitale Modelle, die während des gesamten Projektlebenszyklus – vom ersten Konzept bis zum jahrzehntelangen Betrieb der Anlage – als eine einzige Quelle der Wahrheit dienen.
Die Einführung von BIM in der Baubranche hat sich in den letzten Jahren dramatisch beschleunigt, was auf messbare Verbesserungen der Projektergebnisse zurückzuführen ist. Untersuchungen, die mehrere Fallstudien analysieren, zeigen, dass die Einführung von BIM die Projektlaufzeiten im Durchschnitt um 20 % und die Kosten um 15 % verkürzt und gleichzeitig die Anzahl der Planungsfehler um 30 % reduziert. Das Center for Integrated Facilities Engineering der Stanford University hat nach der Erhebung von Daten zu 32 Großprojekten eine Verkürzung der Projektzeit um bis zu 7% festgestellt. Was als fortschrittliche 3D-Visualisierung begann, hat sich zu umfassenden digitalen Arbeitsabläufen entwickelt, die die Art und Weise, wie Teams zusammenarbeiten, grundlegend verändern.
Die Einführung von BIM ist kein einfacher Prozess, insbesondere bei zivilen Infrastrukturprojekten, bei denen sich die Komplexität der Koordination zwischen den verschiedenen Disziplinen vervielfacht. Die Anfangsinvestitionen – Softwarelizenzen, Schulungen, Prozessänderungen und manchmal auch organisatorische Umstrukturierungen – stellen eine erhebliche Verpflichtung dar. Doch die Vorteile vollständig integrierter BIM-Workflows überwiegen diese anfänglichen Herausforderungen bei weitem. Sie rentieren sich durch höhere Effizienz, weniger Fehler, bessere Koordination und einen Lebenszykluswert, der weit über den Abschluss der Bauarbeiten hinausreicht.
Dieser Leitfaden befasst sich mit der gesamten BIM-Workflow-Landschaft: vom Verständnis der Workflow-Phasen und der Ausführungsplanung bis hin zur Implementierung der Qualitätskontrolle, der Festlegung organisatorischer Standards und der Nutzung neuer Technologien. Unabhängig davon, ob Sie die Einführung von BIM erwägen oder bestehende Prozesse verfeinern, hilft das Verständnis dieser miteinander verbundenen Elemente Unternehmen, den maximalen Nutzen aus ihrer BIM-Investition zu ziehen.
Was ist BIM-Einführung?
Die Einführung von BIM ist kein einfacher Prozess, insbesondere wenn es um BIM-Workflows bei verschiedenen zivilen Infrastrukturprojekten geht. Während die Anfangsinvestition oft als kompliziert angesehen wird, kann man mit Sicherheit sagen, dass die Vorteile eines vollständig integrierten BIM-Workflows die Probleme, die mit der Anfangsinvestition verbunden sind, deutlich überwiegen.
Natürlich besteht eines der Hauptprobleme bei der Einführung darin, dass sich fast alle Personen, die am Entstehungsprozess des Projekts beteiligt sind, an den neuen Ansatz gewöhnen müssen, nicht nur die höheren oder leitenden Angestellten des jeweiligen Unternehmens. Glücklicherweise haben die letzten Jahre einen beeindruckenden Anstieg der BIM-Anwendungsrate gezeigt, was es für Unternehmen, die noch unsicher sind, was das Gleichgewicht zwischen Investition und Endergebnis angeht, noch verlockender macht.
Ein weiterer Teil des Prozesses, der sich deutlich verändert hat, ist der spürbare Return on Investment (ROI) für jedes einzelne Projekt, dank einer Fülle von BIM-bezogenen Vorteilen wie bessere Zeitplanung, weniger Fehler, verbessertes Design und so weiter. Die signifikante Zunahme der BIM-Anwendung bei traditionellen Unternehmen zeigt, dass BIM auch bei zivilen Infrastrukturprojekten mit dem gleichen Nutzen eingesetzt werden kann.
Das soll nicht heißen, dass die Entscheidung selbst der schwierige Teil ist, auch die Methode der Einführung ist ziemlich kompliziert. Letztendlich erfordert die Anwendung von BIM-Workflows eine Menge bedeutender Veränderungen innerhalb des Unternehmens, einschließlich Umrüstung, Schulung, Schaffung neuer Arbeitsplätze und in einigen Fällen auch größere Veränderungen wie die Umstrukturierung von Abteilungen. Die Veränderung selbst muss nicht sofort erfolgen. Es gibt viele Beispiele für Unternehmen, die neuere Arbeitsabläufe mit Pilotprojekten testen und die Änderungen prozessbezogen einführen.
Eine wichtige Auswirkung dieser Art von Veränderungen und BIM-Workflows ist die drastische Steigerung der Möglichkeiten und des LOD (Level of Detail), wenn es um 3D-Designerfahrung geht. Dies ist besonders wichtig, da die meisten Änderungen im BIM-Workflow durch den technologischen Fortschritt in der Branche möglich sind und eine nahtlose Integration, Interoperabilität usw. ermöglichen. Der vereinheitlichte Arbeitsablauf ermöglicht es, dass Modelle verschiedene Entwurfsphasen mit Beiträgen verschiedener am Prozess beteiligter Abteilungen durchlaufen können, ohne dass es zu Verzögerungen durch unterschiedliche Dateiformate oder ähnliche Probleme kommt.
Gegenwärtig gibt es zwei Möglichkeiten, einen BIM-Workflow einzuführen – entweder von Anfang an, oder durch eine Roadmap mit kontinuierlichen Verbesserungen. Die letztere Option dürfte für die meisten Bauprojekte weitaus attraktiver sein, da das Risiko, dass etwas schief geht, in diesem Fall wesentlich geringer ist.
Der BIM-Workflow und warum er so anders ist
Die Behauptung, BIM sei nur eine andere Bezeichnung für 3D-Modellierungssoftware, ist weit von der Wahrheit entfernt. BIM stellt in der Regel den gesamten Wissens- und Informationsschatz über das jeweilige Projekt dar und beseitigt verschiedene Probleme herkömmlicher Arbeitsabläufe wie unterschiedliche Dateiformate, unverbundene Prozesse und die massiven Probleme mit der Synchronisierung des Projekts von Anfang an.
Die Möglichkeit, zu simulieren, Modelle zu erstellen und zu visualisieren, ermöglicht die Beseitigung der meisten Kompatibilitäts- oder Richtlinienfehler, die früher erst während des eigentlichen Bauprozesses gefunden werden konnten. Es ist auch viel einfacher, von verschiedenen Parteien innerhalb des BIM-Workflows Feedback zum aktuellen Modell zu erhalten, was sowohl die Kommunikation als auch die Konfliktlösung wesentlich einfacher und schneller macht.
Um diese Möglichkeiten voll ausschöpfen zu können, folgen Projekte einem strukturierten Ablauf durch verschiedene Workflow-Phasen.
Was sind die wichtigsten Phasen eines BIM-Workflows?
Der BIM-Workflow folgt einem strukturierten Ablauf durch verschiedene Phasen, die jeweils auf der vorherigen Phase aufbauen, um eine umfassende digitale Darstellung des Projekts zu erstellen. Die Kenntnis dieser Phasen hilft den Teams, sich effektiv zu koordinieren und den Wert ihrer BIM-Investitionen zu maximieren, und zwar eine Phase nach der anderen.
Bevor wir uns näher mit den einzelnen Phasen befassen, geben wir Ihnen hier einen kurzen Überblick in Form einer Tabelle:
| Stufe des Arbeitsablaufs | Primärer Schwerpunkt | Schlüsselaktivitäten | Hauptergebnisse |
| Konzeptioneller Entwurf | Durchführbarkeit & Vision | Massenstudien, Standortanalyse, Kostenschätzungen | Vorläufige 3D-Modelle, Budgetrahmen |
| Entwurfsentwicklung | Detaillierte Koordination | Disziplinspezifische Modellierung, Systemintegration | Koordiniertes 3D-Modell, Spezifikationen |
| Kollisionserkennung | Konfliktlösung | Automatisierte Kollisionsprüfung, Koordinierungssitzungen | Kollisionsfreies föderiertes Modell |
| Konstruktionsdokumentation | Produktion von Zeichnungen | 2D-Extraktion, Mengenermittlungen, Werkstattzeichnungen | Konstruktionszeichnungssätze, Materiallisten |
| Bauunterstützung | Feldführung | Fortschrittskontrolle, Unterstützung bei der Vorfertigung | As-Built-Dokumentation |
| Gebäudemanagement | Betrieb & Wartung | Erstellung von digitalen Zwillingen, Wartungsplanung | Gebäudebetriebshandbuch |
Konzeptioneller Entwurf und Planung
In der Konzeptionsphase wird die Grundlage des Projekts durch vorläufige 3D-Modelle geschaffen, die räumliche Beziehungen, Massestudien und erste Designkonzepte untersuchen. Die Teams setzen BIM-Software ein, um mehrere Entwurfsalternativen schnell zu testen und Faktoren wie Standortbeschränkungen, Umweltauswirkungen und Budgetmöglichkeiten zu bewerten.
In dieser Phase prüfen die Beteiligten die visuellen Darstellungen, um sich über die Projektvision zu verständigen, bevor erhebliche Ressourcen eingesetzt werden. Die Modelle sind relativ einfach gehalten, enthalten aber genügend Details, um die Entscheidungsfindung über die Durchführbarkeit und Ausrichtung des Projekts zu unterstützen. Frühe Kostenschätzungen und Zeitplanungsparameter werden ebenfalls in das Modell integriert, um die grundlegenden Erwartungen für den gesamten Lebenszyklus des Projekts festzulegen.
Entwurfsentwicklung und Koordination
Bei der Entwurfsentwicklung werden konzeptionelle Modelle in detaillierte, informationsreiche Darstellungen umgewandelt. Ingenieure, Architekten und Spezialisten fügen ihre disziplinspezifischen Elemente – strukturelle Komponenten, MEP-Systeme, architektonische Details und zivile Infrastrukturelemente – in eine koordinierte Modellumgebung ein.
Diese Phase erfordert eine intensive Zusammenarbeit, da verschiedene Teams gleichzeitig an ihren jeweiligen Systemen arbeiten. Der Detaillierungsgrad des Modells nimmt erheblich zu und umfasst genaue Abmessungen, Materialspezifikationen und Leistungsmerkmale. Die Teams erstellen Koordinationsprotokolle, um sicherzustellen, dass die Arbeiten der einzelnen Disziplinen nahtlos ineinander übergehen und Konflikte vermieden werden, bevor sie die Baustelle erreichen.
Konflikterkennung und Konfliktlösung
Die Kollisionserkennung identifiziert räumliche Konflikte, wenn verschiedene Gebäudesysteme denselben Raum einnehmen, z. B. wenn sich ein Tragwerksträger mit einem HLK-Kanal überschneidet. Die BIM-Software scannt automatisch das Verbundmodell, um diese Konflikte zu lokalisieren, und kategorisiert sie nach Schweregrad und Art.
Die Teams setzen Prioritäten und lösen die Konflikte in Koordinierungssitzungen und passen die Entwürfe an, um Störungen zu beseitigen. Dieser proaktive Ansatz verhindert kostspielige Verzögerungen und Nacharbeiten vor Ort. Der Prozess wird iterativ wiederholt, wenn sich die Entwürfe weiterentwickeln, so dass während der gesamten Entwicklung ein kollisionsfreies Modell erhalten bleibt. Harte Konflikte (physische Überschneidungen) werden sofort behoben, während weiche Konflikte (Abstandsverletzungen) auf der Grundlage von Projektstandards und Zugänglichkeitsanforderungen behandelt werden.
Baudokumentation
Die Baudokumentation extrahiert 2D-Zeichnungen, Zeitpläne und Spezifikationen direkt aus dem koordinierten 3D-Modell. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Dokumentationen die gleiche Quelle der Wahrheit widerspiegeln und die Diskrepanzen zwischen Zeichnungen, die bei herkömmlichen Arbeitsabläufen auftreten, beseitigt werden.
Das Modell generiert automatisch genaue Mengenangaben, Materiallisten und Kostenvoranschläge. Die Bauteams erhalten Zeichnungssätze, die über alle Blätter hinweg konsistent sind, wobei Änderungen im Modell automatisch auf die entsprechende Dokumentation übertragen werden. In dieser Phase werden auch Werkstattzeichnungen und Fertigungsdetails erstellt, die von den Herstellern verwendet werden, um Gebäudekomponenten mit Präzision zu fertigen.
Unterstützung für Konstruktion und Fertigung
Während der Bauphase dient das BIM-Modell als Referenz für die Teams vor Ort und als Werkzeug zur Verfolgung des Fortschritts. Bauunternehmer verwenden mobile Geräte, um vor Ort auf die Modellinformationen zuzugreifen und die Installationsdetails und die Reihenfolge der Arbeiten zu überprüfen. Das Modell unterstützt die 4D-Planung, indem es die Bauaktivitäten mit bestimmten Modellelementen verknüpft, um den Bauablauf zu visualisieren.
Vorfertigung und modulare Bauweise stützen sich in hohem Maße auf BIM-Daten, wobei die Hersteller präzise digitale Spezifikationen für die Fertigung außerhalb der Baustelle erhalten. Dadurch wird die Materialverschwendung reduziert und die Qualitätskontrolle verbessert. Der Ist-Zustand wird dokumentiert, indem das Modell aktualisiert wird, um die tatsächliche Konstruktion widerzuspiegeln, wodurch eine genaue Aufzeichnung für das Facility Management entsteht.
Gebäudemanagement und Betrieb
In der letzten Phase wird das BIM-Modell für den laufenden Betrieb und die Wartung an den Gebäudeeigentümer übergeben. Das Modell wird zu einem digitalen Zwilling, der Ausrüstungsspezifikationen, Garantieinformationen, Wartungspläne und Betriebsdaten enthält. Gebäudemanager nutzen diese Informationen, um Wartungsaktivitäten zu planen, die Raumaufteilung zu verwalten und Renovierungen effizient durchzuführen.
Diese Phase bietet einen langfristigen Wert, da das institutionelle Wissen über die Systeme und die Konstruktion des Gebäudes erhalten bleibt. Wenn Renovierungen oder Erweiterungen anstehen, haben die Teams sofortigen Zugriff auf genaue Gebäudedaten, was die Untersuchungszeit verkürzt und die Projektplanung für zukünftige Änderungen verbessert.
Was sind die Vorteile und Herausforderungen bei der Implementierung von BIM?
Die Vorteile und Hindernisse der BIM-Implementierung zu verstehen, hilft Unternehmen, realistische Erwartungen zu setzen und entsprechend zu planen. BIM bietet zwar während des gesamten Projektlebenszyklus einen erheblichen Nutzen, aber um diesen Nutzen zu erzielen, müssen echte Herausforderungen bei der Implementierung gemeistert werden.
Die wichtigsten Vorteile integrierter BIM-Workflows
BIM-Arbeitsabläufe verändern die Art und Weise, wie Teams Bauprojekte entwerfen, koordinieren und durchführen, durch mehrere messbare Verbesserungen:
- Verbesserte Zusammenarbeit: Alle Disziplinen arbeiten auf der Grundlage eines koordinierten Modells, wodurch Missverständnisse vermieden werden und eine Designkoordination in Echtzeit möglich ist, die Konflikte vor Baubeginn verhindert.
- Verbesserte Genauigkeit und Effizienz: Durch die automatisierte Kollisionsprüfung, Mengenermittlung und Dokumentationserstellung werden manuelle Fehler vermieden und der Zeitaufwand für sich wiederholende Aufgaben reduziert.
- Kosteneinsparungen: Frühzeitige Konfliktlösung, weniger Nacharbeit und genaue Materialmengen senken die Gesamtprojektkosten trotz höherer Investitionen in die Planung.
- Bessere Terminplanung und Ablaufplanung: Die 4D-Simulation visualisiert die Bauabläufe, identifiziert logistische Einschränkungen und optimiert die Zeitpläne, bevor die Teams auf der Baustelle eintreffen.
- Nachhaltigkeit und Leistung: Energieanalysen, Studien zur Tageslichtbeleuchtung und Materialoptimierung finden während der Planung statt, wenn Änderungen weniger kosten als nach dem Bau.
- Lebenszyklus-Wert: Facility Manager erhalten umfassende Gebäudedaten, die die Instandhaltungsplanung, das Raummanagement und künftige Renovierungen für Jahrzehnte nach dem Bau unterstützen.
- Hochwertige Dokumentation: Konsistente, koordinierte Zeichnungen, die direkt aus dem Modell generiert werden, eliminieren die Diskrepanzen zwischen Blättern, die bei herkömmlichen Dokumentationsmethoden auftreten.
Zu bewältigende Herausforderungen bei der Implementierung
Unternehmen, die BIM-Workflows einführen, stoßen auf mehrere Hindernisse, die eine strategische Planung erfordern:
- Hohe Anfangsinvestitionen: Softwarelizenzen, Hardware-Upgrades, Schulungsprogramme und Beraterunterstützung erfordern ein erhebliches Kapital, bevor sich die Projekte rentieren.
- Kultureller Widerstand: Teammitglieder, die mit traditionellen Methoden vertraut sind, sträuben sich gegen Änderungen der Arbeitsabläufe, insbesondere wenn die Lernkurve die Produktivität vorübergehend verringert.
- Schulungsbedarf: Die effektive Nutzung von BIM erfordert einen erheblichen Schulungsaufwand, nicht nur für Softwarekenntnisse, sondern auch für das Verständnis von kollaborativen Arbeitsabläufen und neuen Verantwortlichkeiten.
- Probleme mit der Interoperabilität: Trotz offener Standards kommt es beim Datenaustausch zwischen verschiedenen Softwareplattformen immer noch zu Reibungsverlusten, da Dateiformate konvertiert und regelmäßige Qualitätsprüfungen durchgeführt werden müssen.
- Erhöhter Aufwand im Vorfeld: BIM verlagert die Arbeit in die Entwurfsphasen und erfordert eine detailliertere Planung und Koordination vor dem Bau, als dies bei traditionellen Ansätzen der Fall ist.
- Komplexität der Software: Moderne BIM-Tools bieten leistungsstarke Funktionen, haben aber eine steile Lernkurve, und die Teams brauchen Zeit, um ihre Fähigkeiten zu entwickeln, bevor sie ihre maximale Effizienz erreichen.
- Zeit für die Entwicklung von Standards: Die Erstellung unternehmensweiter Standards, Vorlagen und Verfahren erfordert monatelange Anstrengungen, bevor das erste Projekt von den optimierten Arbeitsabläufen profitiert.
Eine erfolgreiche BIM-Einführung erkennt diese Herausforderungen bereits im Vorfeld und begegnet ihnen durch eine schrittweise Implementierung, angemessene Schulungen und realistische Zeitvorgaben, anstatt eine sofortige Umstellung zu erwarten.
Wie planen Sie die BIM-Ausführung für ein Projekt?
Ein BIM-Ausführungsplan (BEP) fungiert als endgültiger Leitfaden für die Umsetzung von BIM-Prozessen durch ein Projektteam, in dem Rollen, Standards, Ergebnisse und Protokolle für die Zusammenarbeit vor Beginn der Arbeiten festgelegt werden. Ohne diesen Fahrplan riskieren Teams Missverständnisse, inkompatible Ergebnisse und vergeudeten Aufwand zwischen den Disziplinen.
Was sollte eine Projektcharta enthalten?
Die Projektcharta legt die grundlegenden Vereinbarungen zwischen allen Beteiligten fest – Eigentümer, Planer, Auftragnehmer und Berater. In diesem Dokument werden die Projektziele, die BIM-Ziele und die Verantwortlichkeiten der einzelnen Parteien innerhalb des digitalen Workflows festgelegt.
Die Entwicklung der Charta beginnt mit einem Kickoff-Meeting, bei dem die Beteiligten ihre Erwartungen besprechen, potenzielle Hindernisse identifizieren und sich auf Erfolgsmaßstäbe einigen. Die Charta befasst sich mit Fragen wie den Informationen, die jede Partei benötigt, wer für welche Modellelemente verantwortlich ist, wie die Teams Daten austauschen und wann die wichtigsten Koordinationsmeilensteine erreicht sind. Eine frühzeitige Abstimmung zwischen allen Beteiligten verhindert Konflikte, die entstehen, wenn die Annahmen nicht mit der Realität übereinstimmen.
Welche BIM-Anwendungsfälle sollten Sie vorrangig behandeln?
Anwendungsfall-Checklisten identifizieren die spezifischen BIM-Anwendungen, die für Ihr Projekt relevant sind, wie z.B. 3D-Koordination, Mengenermittlung, Bauablaufplanung, Energieanalyse oder Facility Management. Nicht jedes Projekt erfordert alle BIM-Funktionen, so dass die Checkliste die Anwendungen priorisiert, die den größten Nutzen bringen.
Die Teams bewerten jeden Anwendungsfall anhand der Projektziele und der Verfügbarkeit von Ressourcen. Bei einem Renovierungsprojekt könnte der Schwerpunkt auf der Modellierung des bestehenden Zustands und der Phasensimulation liegen, während bei einem neuen Infrastrukturprojekt die Kollisionserkennung und die Analyse der Konstruierbarkeit im Vordergrund stehen könnten. Die Checkliste wird zu einem Umfangsdokument, das eine schleichende Ausweitung des Umfangs verhindert und dafür sorgt, dass sich die BIM-Bemühungen auf die Erzielung greifbarer Ergebnisse konzentrieren.
Festlegen von Standards und Konventionen
Die Standardisierung umfasst sowohl die 2D-Dokumentation als auch die Konventionen für die 3D-Modellierung. Die Teams müssen sich auf Namenskonventionen, Layerstrukturen, Ebenendefinitionen, Koordinatensysteme, Einheitenstandards und Modellierungstoleranzen einigen, bevor jemand eine Geometrie erstellt.
Dokumentationsstandards legen Blattlayouts, die Informationen in Titelblöcken, Beschriftungsstile und Zeichnungsmaßstäbe fest. Modellierungsstandards definieren die Anforderungen an die Entwicklungsebene (LOD) für jede Projektphase und stellen sicher, dass die Modelle einen angemessenen Detaillierungsgrad aufweisen, ohne übermäßige Informationen, die die Leistung beeinträchtigen. Diese Vereinbarungen verhindern das Chaos inkompatibler Dateien und fehlinterpretierter Informationen zwischen den Disziplinen.
Auswahl von Software und Tools für die Zusammenarbeit
Im BEP wird festgelegt, welche Softwareplattformen jede Disziplin verwendet und wie diese Tools Informationen austauschen. Da die Teams oft mit unterschiedlichen Erstellungsanwendungen arbeiten – Revit für die Architektur, Civil 3D für die Infrastruktur, Tekla für den Stahlbau – legt der Plan gemeinsame Datenformate (in der Regel IFC) und Kooperationsplattformen für die gemeinsame Nutzung von Modellen fest.
Zu den Auswahlkriterien gehören Interoperabilitätsfunktionen, Fachwissen des Teams, Projektkomplexität und Anforderungen des Eigentümers. Der Plan bestimmt auch Plattformen für die Zusammenarbeit bei der Problemverfolgung, bei Modellkoordinierungssitzungen und bei der Dokumentenverwaltung. Cloud-basierte Lösungen ermöglichen den Zugriff in Echtzeit, allerdings muss der Plan die Datensicherheit und Versionskontrollprotokolle berücksichtigen.
Beibehaltung der Flexibilität des Plans
Die BIM-Technologie entwickelt sich schnell weiter, und die Projektbedingungen ändern sich. Der Ausführungsplan bleibt ein lebendiges Dokument, das sich anpasst, wenn Teams effizientere Arbeitsabläufe entdecken oder auf unvorhergesehene Herausforderungen stoßen. In regelmäßigen Besprechungen wird geprüft, ob die aktuellen Prozesse den Projektzielen dienen oder angepasst werden müssen.
Flexibilität bedeutet nicht, dass Standards aufgegeben werden – es bedeutet, dass erkannt wird, wenn Änderungen die Ergebnisse verbessern. Ein Team könnte mitten im Projekt einen neuen Arbeitsablauf zur Kollisionserkennung einführen, wenn sich dieser als effektiver erweist, und den BEP entsprechend aktualisieren. Diese Anpassungsfähigkeit stellt sicher, dass der Plan das Team unterstützt und nicht die Innovation einschränkt.
Wie standardisieren Sie BIM-Arbeitsabläufe in Ihrem Unternehmen?
Ausführungspläne auf Projektebene brauchen eine Grundlage, auf der sie aufbauen können. Unternehmensweite BIM-Standards schaffen Konsistenz über alle Projekte hinweg und ermöglichen es den Teams, zwischen Aufträgen zu wechseln, ohne die Prozesse neu erlernen zu müssen, und ermöglichen es dem Unternehmen, die Implementierung von BIM effizient zu skalieren.
Definition von BIM-Rollen und Verantwortlichkeiten
Klare Rollendefinitionen verhindern Verantwortungslücken und sich überschneidende Befugnisse, die Projekte verlangsamen. Die meisten Unternehmen, die BIM einführen, richten mehrere Schlüsselpositionen ein:
Der BIM-Manager überwacht die gesamte BIM-Strategie des Unternehmens, entwickelt Unternehmensstandards, wählt Softwareplattformen aus und stellt sicher, dass die Projekte mit den Unternehmenszielen übereinstimmen. Diese Rolle konzentriert sich eher auf den langfristigen Aufbau von Fähigkeiten als auf die tägliche Projektausführung.
Projektleiter setzen die Unternehmensstandards in projektspezifische Ausführungspläne um, koordinieren die verschiedenen Disziplinen und stellen sicher, dass die Ergebnisse den Kundenanforderungen entsprechen. Sie dienen als Hauptansprechpartner für BIM-bezogene Entscheidungen bei einzelnen Projekten.
Modellmanager sorgen für die Qualität der Modelle, setzen Modellierungsstandards durch, übernehmen Koordinationsaufgaben und verwalten die technischen Aspekte der Modellproduktion. Jede Disziplin hat in der Regel ihren eigenen Modellmanager, der für ihren Teil des Verbundmodells verantwortlich ist.
Die Teammitglieder erstellen Modellinhalte gemäß den festgelegten Standards, nehmen an Koordinierungssitzungen teil und implementieren Designänderungen. Sie legen zwar nicht die Standards fest, aber ihr Feedback über die Effizienz der Arbeitsabläufe trägt dazu bei, die Unternehmensprozesse im Laufe der Zeit zu verfeinern.
Softwarekonfiguration und Standardisierung
Konsistenz beginnt mit identischen Softwarekonfigurationen im gesamten Team. Jeder verwendet dieselbe Version der Software, lädt dieselben Add-Ins und wendet dieselben Konfigurationseinstellungen an. Nicht übereinstimmende Versionen verursachen Probleme mit der Dateikompatibilität, während unterschiedliche Add-Ins Geometrien erzeugen, die andere nicht richtig bearbeiten können.
Unternehmen pflegen Standardsoftwarevorlagen, die vorkonfigurierte Einstellungen enthalten: Einheitensysteme, Genauigkeitsstufen, Fangeinstellungen, Ansichtsvorlagen und Standardmaterialien. Neue Teammitglieder erhalten diese Vorlagen bei der Einarbeitung, so dass es keine Abweichungen bei der Einrichtung gibt. Wenn Software-Updates veröffentlicht werden, prüft der BIM Manager die Kompatibilität und plant koordinierte Upgrades, um eine Versionsfragmentierung zu verhindern.
Dateiorganisation und Benennungskonventionen
Strukturierte Ordnerhierarchien und eine einheitliche Namensgebung verhindern das Chaos verlorener Dateien und unklarer Versionen. Unternehmen richten Standard-Ordnerstrukturen ein, die Modelle nach Disziplinen trennen, Blätter nach Typ ordnen und eine klare Versionshistorie führen. Jeder weiß, wo die aktuellen Dateien zu finden sind und wo neue Arbeiten zu speichern sind.
Die Namenskonventionen folgen vorhersehbaren Mustern, die den Dateiinhalt, die Disziplin, die Ebene und die Version auf einen Blick vermitteln. Eine Datei mit dem Namen„ARC_L02_Core_v2.3.rvt“ weist sich sofort als Architekturmodell, zweite Ebene, Kernbereich, Version 2.3 aus. Diese Konventionen gelten nicht nur für Modelle, sondern auch für Blätter, Ansichten, Familien und die gesamte Projektdokumentation. Die standardisierte Benennung ermöglicht eine automatisierte Dateiverwaltung und reduziert den Zeitaufwand für die Suche nach Informationen.
Modellierungs- und Dokumentationsstandards
Modellierungsstandards definieren, wie Teams Gebäudeelemente darstellen, um Konsistenz und Interoperabilität zu gewährleisten. Diese Standards umfassen die Elementkategorisierung (die Revit-Kategorie jeder Komponente), Modellierungstoleranzen (akzeptable Lücken und Überlappungen) und den Grad der Entwicklungsanforderungen für jede Phase des Projekts.
Dokumentationsstandards regeln Anmerkungsstile, Bemaßungsformatierungen, Linienstärken, Textgrößen und Blattlayouts. Die Teams erstellen standardisierte Blattvorlagen, Titelblöcke und Ansichtsvorlagen, die eine einheitliche grafische Darstellung für alle Projekte gewährleisten. Standard-Detailbibliotheken bieten vorgezeichnete typische Bedingungen, die die Qualität erhalten und gleichzeitig die Dokumentation beschleunigen. Zu den wichtigsten Bereichen der Standardisierung gehören:
- Systeme zur Benennung und Nummerierung von Elementen, die die Komponenten während des Entwurfs und der Konstruktion verfolgen
- Material- und Ausführungsspezifikationen mit einheitlichen Eigenschaftsdefinitionen
- Organisation und Benennung von Ansichten, die eine intuitive Navigation ermöglichen
- Regeln für die Platzierung von Anmerkungen, um unübersichtliche Zeichnungen zu vermeiden
- Richtlinien für die Blattgestaltung, die ein Gleichgewicht zwischen Informationsdichte und Lesbarkeit herstellen
Qualitätsaudits und kontinuierliche Verbesserung
Regelmäßige Audits stellen sicher, dass die Projekte den Unternehmensstandards entsprechen und zeigen Bereiche auf, in denen die Standards verfeinert werden müssen. In monatlichen oder vierteljährlichen Überprüfungen werden die Modellierungspraktiken, die Dateiorganisation und die Qualität der Dokumentation in allen aktiven Projekten untersucht. Aus den Prüfungsergebnissen ergeben sich Aktionspunkte für sofortige Korrekturen und Aktualisierungen der Standards.
Die Standards entwickeln sich weiter, wenn die Teams bessere Arbeitsabläufe entdecken und neue Möglichkeiten entstehen. Der BIM-Manager holt das Feedback der Projektteams ein, bewertet die vorgeschlagenen Verbesserungen und aktualisiert die Standards entsprechend. Dieser kontinuierliche Verbesserungszyklus sorgt dafür, dass die Standards relevant und praktisch bleiben und nicht zu bürokratischen Hindernissen werden, die die Teams umgehen müssen.
Welche Software und Tools werden für BIM-Workflows benötigt?
Das BIM-Ökosystem umfasst Dutzende von Spezialanwendungen, die jeweils für bestimmte Disziplinen und Projektphasen entwickelt wurden. Die Auswahl der richtigen Tools hängt von der Art des Projekts, dem Fachwissen des Teams und den Anforderungen an die Zusammenarbeit ab, wobei die meisten Arbeitsabläufe mehrere Anwendungen kombinieren, anstatt sich auf eine einzige Plattform zu verlassen.
Tools für Erstellung und Entwurf
Tools für die Entwurfserstellung erstellen die primären BIM-Modelle, die die Projektkoordination und -dokumentation vorantreiben. Autodesk Revit dominiert mit seinem parametrischen Modellierungsansatz und seinem umfassenden Funktionsumfang die Bereiche Architektur, Hochbau und MEP-Design. AutoCAD Civil 3D eignet sich für zivile Infrastrukturprojekte wie Straßen, Planierungen, Versorgungseinrichtungen und die Erschließung von Grundstücken mit speziellen Tools für Vermessungsdaten und Korridormodellierung.
Bentley Systems bietet mit Anwendungen wie MicroStation, OpenBuildings Designer und OpenRoads Designer unternehmensweite Lösungen für Infrastruktur- und Industrieprojekte. Diese Werkzeuge eignen sich hervorragend für große, komplexe Infrastrukturen, bei denen Interoperabilität mit GIS-Daten und fortschrittliche Analysefunktionen wichtig sind. Tekla Structures hat sich auf die Detaillierung von Stahl- und Betonfertigteilen spezialisiert und erstellt fertigungsreife Modelle mit präzisen Verbindungsdetails.
ArchiCAD bietet eine Alternative zu Revit für die Architekturplanung. Es ist vor allem in Europa und bei Firmen beliebt, die den Design-Workflow über die technische Integration stellen. Vectorworks dient der Architektur und dem Unterhaltungsdesign mit starken Visualisierungs- und Präsentationsfunktionen.
Koordinations-, Analyse- und Visualisierungstools
Über die Erstellung hinaus benötigen Projekte spezialisierte Tools für bestimmte Aufgaben:
- Navisworks für Modellverbund, Kollisionserkennung und 4D-Konstruktionsablaufplanung
- Solibri Office für die Qualitätskontrolle, Codeprüfung und Modellvalidierung
- Autodesk Construction Cloud für Projektzusammenarbeit, Dokumentenmanagement und mobilen Zugriff vor Ort
- Bluebeam Revu für PDF-basierte Koordinations-, Markup- und Dokumentations-Workflows
- Enscape und Twinmotion für Echtzeit-Visualisierung und Kundenpräsentationen
- Revizto für Problemverfolgung, Koordinationsbesprechungen und Konfliktlösungs-Workflows
Teams verwenden selten alle diese Tools. Es kommt darauf an, eine Kombination zu wählen, die den projektspezifischen Anforderungen entspricht, ohne die Arbeitsabläufe zu verkomplizieren oder unnötige Lizenzkosten zu verursachen.
Was ist openBIM und warum ist Interoperabilität wichtig?
Die Interoperabilität entscheidet darüber, ob Projektteams Informationen nahtlos zwischen verschiedenen Softwareplattformen austauschen können oder ob sie in der Falle sitzen, Dateien zu übersetzen und dabei Daten zu verlieren. Der openBIM-Ansatz bietet einen Rahmen für die herstellerneutrale Zusammenarbeit und stellt sicher, dass Projektinformationen unabhängig von den verwendeten Tools zugänglich bleiben.
Was ist der openBIM-Rahmen?
openBIM ist kein einzelnes Softwareprodukt oder ein Arbeitsablauf – es ist ein universeller Ansatz für die Zusammenarbeit bei Planung, Bau und Betrieb, der auf offenen Standards und Arbeitsabläufen basiert. openBIM wurde von buildingSMART International entwickelt und ermöglicht den Datenaustausch zwischen Anwendungen verschiedener Anbieter ohne proprietäre Einschränkungen oder Datenverlust.
Dieses Framework erkennt an, dass keine einzelne Softwarelösung alle Projektanforderungen erfüllt. Architekten bevorzugen bestimmte Werkzeuge, Bauingenieure verwenden andere, und Planer für Haustechnik haben ihre eigenen spezialisierten Anwendungen. openBIM ermöglicht es jeder Disziplin, in ihrer optimalen Umgebung zu arbeiten und gleichzeitig ein verbundenes, koordiniertes Projektmodell zu erhalten. Das Ergebnis ist eine echte Zusammenarbeit und keine erzwungene Standardisierung auf einer einzigen Plattform.
Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass die Einführung von openBIM ab 2025 von ISO 19650 unterstützt wird.
Wichtige openBIM-Standards
Mehrere miteinander verbundene Standards bilden die Grundlage der openBIM-Workflows, die jeweils bestimmte Aspekte des Datenaustauschs und der Zusammenarbeit behandeln:
Industry Foundation Classes (IFC) dienen als Lingua Franca für den BIM-Datenaustausch. Es handelt sich dabei um ein offenes Dateiformat, das Daten aus dem Bauwesen herstellerneutral beschreibt. Wenn ein Statiker eine IFC-Datei aus seiner Modellierungssoftware exportiert, kann ein Architekt dieselbe Datei in seine Plattform importieren und genau auf die Strukturinformationen zugreifen. IFC definiert standardisierte Darstellungen für Gebäudeelemente (Wände, Balken, Räume), die Beziehungen zwischen den Elementen und die mit den einzelnen Komponenten verbundenen Eigenschaften.
Das BIM Collaboration Format (BCF) ermöglicht es Teams, Probleme, Kommentare und Koordinierungshinweise zu kommunizieren, ohne ganze Modelldateien auszutauschen. Wenn jemand einen Konflikt oder eine Designfrage identifiziert, erstellt er ein BCF-Problem, das eine 3D-Ansicht, eine Beschreibung, eine zugewiesene Verantwortung und eine Statusverfolgung enthält – alles in einer schlanken XML-Datei. Dieses am Arbeitsablauf orientierte Format rationalisiert Koordinierungssitzungen und Problemlösungen und arbeitet mit verschiedenen BIM-Anwendungen, so dass ein in einem Tool erstelltes Problem in einem anderen korrekt angezeigt wird.
Die Information Delivery Specification (IDS) definiert genau, welche Informationen in den verschiedenen Projektphasen in die BIM-Dokumente aufgenommen werden müssen. Anstelle von vagen Anforderungen wie „ein Architekturmodell bereitstellen“ legt die IDS genau fest, welche Eigenschaften, Klassifizierungen und Attribute für die einzelnen Elementtypen erforderlich sind, ausgedrückt in einem maschinenlesbaren Format, das die Software automatisch validiert.
| Standard | Zweck | Primärer Anwendungsfall | Dateityp |
| IFC (Industry Foundation Classes) | Modelldatenaustausch | Austausch vollständiger Gebäudemodelle zwischen verschiedenen Softwareplattformen | .ifc |
| BCF (BIM Collaboration Format) | Kommunikation von Problemen | Dokumentation von Konflikten, Fragen und Koordinationspunkten ohne vollständigen Modellaustausch | .bcfzip, .bcf |
| IDS (Information Delivery Specification) | Informationsanforderungen | Definieren und Validieren, welche Daten in den Deliverables enthalten sein müssen | .ids (XML) |
Warum offene Standards wichtig sind
Proprietäre Datenformate führen zu einer Anbieterbindung, bei der Teams weiterhin spezielle Software für den Zugriff auf ihre eigenen Projektdaten verwenden müssen. Offene Standards bieten mehrere entscheidende Vorteile:
- Langfristiger Zugang zu Daten, die auch Jahrzehnte nach dem Bau noch nutzbar sind
- Freiheit bei der Auswahl der besten Tools für jede Disziplin ohne Kompatibilitätsprobleme
- Ein wettbewerbsfähiger Softwaremarkt, der Innovationen fördert und Kosten senkt
- Investitionsschutz, indem sichergestellt wird, dass BIM-Daten nicht veraltet sind, wenn Anbieter die Richtung ändern
- Leichtere Zusammenarbeit mit internationalen Partnern, die unterschiedliche Software-Ökosysteme verwenden
Insbesondere für Bauherren bedeuten offene Standards Flexibilität bei der Auswahl von Dienstleistern und die Gewissheit, dass ihre Investition in BIM-Daten während des gesamten Lebenszyklus des Gebäudes ihren Wert behält.
Wie stellen Sie die Qualität und Genauigkeit eines BIM-Modells sicher?
Die Modellvalidierung stellt sicher, dass die BIM-Daten die Projektanforderungen erfüllen, den Bauvorschriften entsprechen und genaue Informationen enthalten, bevor sie an die Bauteams weitergeleitet werden. Ohne eine systematische Qualitätskontrolle häufen sich die Fehler im Laufe der Projektphasen und führen zu Nacharbeiten, Verzögerungen und Kostenüberschreitungen, die den Wert von BIM untergraben.
Welche Validierungsprüfungen sind wichtig?
Die Qualitätskontrolle umfasst mehrere Validierungsebenen, die jeweils verschiedene Arten von Fehlern auffangen:
Die Kollisionserkennung identifiziert räumliche Konflikte, bei denen sich Gebäudesysteme gegenseitig behindern. Harte Konflikte sind physische Überschneidungen – ein Kanal, der durch einen Balken verläuft – während weiche Konflikte Abstandsverletzungen sind, wie z.B. ein unzureichender Wartungszugang. Die automatische Kollisionserkennungssoftware scannt die verknüpften Modelle kontinuierlich und markiert Tausende von potenziellen Konflikten, die bei einer manuellen Überprüfung übersehen würden. Die Teams priorisieren Konflikte nach Schweregrad und Systemkritikalität und lösen sie durch Designanpassungen, bevor die Fertigung beginnt.
Die Einhaltung der Projektinformationen überprüft, ob die Modellelemente die erforderlichen Datenattribute enthalten. Ein Türelement sollte die Brandschutzklasse, die Beschlagsspezifikationen, die akustische Leistung und andere Eigenschaften enthalten, die nachgelagerte Prozesse benötigen. Fehlende oder unvollständige Informationen führen zu Engpässen bei der Erstellung von Zeitplänen oder bei der Materialbestellung durch das Beschaffungsteam. Validierungsregeln überprüfen, ob die angegebenen Eigenschaften vorhanden sind und sinnvolle Werte enthalten, um Datenlücken frühzeitig im Arbeitsablauf zu erkennen.
Die Überprüfung der Einhaltung von Vorschriften vergleicht die Geometrie und die Eigenschaften des Modells mit Bauvorschriften, Zugänglichkeitsstandards und projektspezifischen Anforderungen. Dazu gehören Fluchtweganalysen, Belegungsberechnungen, die Überprüfung der Brandabstände und die Einhaltung der Barrierefreiheit. Die automatisierte Überprüfung von Vorschriften reduziert den manuellen Aufwand für die Überprüfung von Tausenden von gesetzlichen Anforderungen und verbessert gleichzeitig die Genauigkeit und Dokumentation.
Wie implementieren Sie eine automatisierte Validierung?
Manuelle Qualitätsprüfungen werden mit zunehmender Modellkomplexität unpraktisch. Automatisierte Validierungstools wie Solibri Office scannen Modelle anhand von vordefinierten Regelsätzen und erstellen Berichte, die nicht konforme Elemente hervorheben. Diese Tools überprüfen alles von Modellierungsstandards (korrekte Platzierung von Elementen, korrekte Kategorien) bis hin zu gesetzlichen Anforderungen (Mindestbreiten von Korridoren, korrekte Brandschutzklassen).
Die Validierung erfolgt zu verschiedenen Projektmeilensteinen – wöchentlich während des aktiven Entwurfs, vor wichtigen Koordinierungssitzungen und als formale Qualitätsprüfungen vor Phasenübergängen. Die automatisierte Überprüfung liefert konsistente Ergebnisse, unabhängig davon, wer die Überprüfung durchführt, und eliminiert die Variabilität der manuellen Prüfung. Teams entwickeln benutzerdefinierte Regelsätze, die auf die Standards ihres Unternehmens und projektspezifische Anforderungen zugeschnitten sind, und bauen so institutionelles Wissen in die Validierungsprozesse ein.
Der Standard Information Delivery Specification (IDS)
IDS bietet eine maschinenlesbare Sprache für die Definition von Informationsanforderungen, wodurch Validierungsspezifikationen projektübergreifend übertragbar und durch Software durchsetzbar werden. Anstatt PDF-Dokumente zu verteilen, die die Anforderungen an die zu liefernden Informationen beschreiben, tauschen die Teams IDS-Dateien aus, die von der Software direkt gelesen werden können.
Eine IDS-Datei spezifiziert Anforderungen wie „Alle Wände müssen Feuerwiderstandsklassen und Wärmedurchlässigkeitseigenschaften enthalten“ oder „Mechanische Geräte müssen Hersteller, Modellnummer, Wartungsplan und Garantieinformationen enthalten.“ Die Software prüft die Modelle automatisch anhand dieser Spezifikationen und erstellt Berichte, in denen genau angegeben ist, bei welchen Elementen die erforderlichen Informationen fehlen. Dieser standardisierte Ansatz beseitigt unterschiedliche Interpretationen und ermöglicht es den Kunden, die Ergebnisse objektiv zu überprüfen.
Qualität in den Prozess einbauen
Qualitätskontrolle funktioniert am besten als kontinuierliche Praxis und nicht als Endkontrolle. Teams, die die Validierung in die täglichen Arbeitsabläufe integrieren, erkennen Fehler, wenn sie am einfachsten zu beheben sind, bevor nachgelagerte Arbeiten mit fehlerhaften Informationen durchgeführt werden. Regelmäßige Qualitätsaudits halten die Modellierungsstandards aufrecht und verhindern ein Abdriften, wenn sich die Projektteams vergrößern oder verändern.
Ein erfolgreiches Qualitätsmanagement erfordert das Zusammenspiel mehrerer Komponenten:
- Klare Modellierungsstandards, die im BIM-Ausführungsplan dokumentiert sind
- Schulungen, die sicherstellen, dass alle Teammitglieder die Qualitätserwartungen verstehen
- Automatisierte Validierungstools, die mit projektspezifischen Regelsätzen konfiguriert sind
- Regelmäßige Qualitätsbesprechungen, bei denen die Teams wiederkehrende Probleme diskutieren
- Rechenschaftssysteme, die Qualitätsmetriken verfolgen und kontinuierliche Verbesserungen fördern
Wenn die Qualität zur Aufgabe eines jeden Einzelnen wird und nicht nur ein separater Überprüfungsschritt ist, produzieren die Teams sauberere Modelle, die reibungslos durch den Bau und in das Facility Management fließen.
Was sind die zukünftigen Trends in der BIM-Technologie?
BIM-Arbeitsabläufe entwickeln sich ständig weiter, da neue Technologien die Möglichkeiten in den Bereichen Design, Bau und Facility Management erweitern. Diese Innovationen versprechen, BIM intelligenter und zugänglicher zu machen und in umfassendere Initiativen zur digitalen Transformation der gesamten gebauten Umwelt zu integrieren.
Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen
Ab 2025 verwandelt die Integration von KI BIM von einer passiven Datenbank in einen aktiven Planungsassistenten. Algorithmen des maschinellen Lernens können Tausende vergangener Projekte analysieren, um optimale Layouts vorzuschlagen, Entwurfsmuster zu erkennen, die zu Konstruktionsproblemen führen, und Projektrisiken auf der Grundlage von Modelleigenschaften vorherzusagen. Generative Designtools erforschen automatisch Tausende von Designvarianten und optimieren gleichzeitig für mehrere Ziele wie Kosten, Energieeffizienz und strukturelle Effizienz.
Die KI-gestützte Codeprüfung geht über die regelbasierte Validierung hinaus und interpretiert die Absicht der Gesetzgeber, indem sie Zusammenhänge und Ausnahmen erkennt, die bei starren Regeln nicht berücksichtigt werden. Die Verarbeitung natürlicher Sprache ermöglicht es Planern, Modelle im Dialog abzufragen, indem sie z.B. fragen: „Zeigen Sie mir alle Brandschutztüren auf Ebene drei“, anstatt durch komplexe Filtermenüs zu navigieren. Da diese Fähigkeiten immer ausgereifter werden, übernimmt die KI Routineaufgaben, während sich die Designer auf kreative Problemlösungen und die Zusammenarbeit mit den Beteiligten konzentrieren.
Digitale Zwillinge und Datenintegration in Echtzeit
Digitale Zwillinge erweitern BIM über die Konstruktion hinaus auf die betriebliche Intelligenz (in Anlehnung an die entstehenden ISO 23247-Standards), indem sie dynamische virtuelle Repliken erstellen, die die physische Gebäudeleistung in Echtzeit widerspiegeln. Sensoren im gesamten Gebäude speisen Daten – Temperatur, Belegung, Energieverbrauch und Gerätestatus – in den digitalen Zwilling ein und ermöglichen so eine vorausschauende Wartung und Leistungsoptimierung.
Diese vernetzten Modelle erkennen Ineffizienzen wie z.B. die Überkühlung leerer Räume durch HLK-Systeme oder den bevorstehenden Ausfall von Geräten, bevor es zu Ausfällen kommt. Gebäudemanager simulieren betriebliche Änderungen virtuell, bevor sie sie physisch umsetzen, und testen Strategien wie veränderte Temperatursollwerte oder geänderte Lüftungspläne. Digitale Zwillinge verwischen die Grenze zwischen Entwurfsabsicht und betrieblicher Realität, wobei die Leistungsdaten des Ist-Zustandes als Grundlage für zukünftige Entwurfsentscheidungen dienen.
Anwendungen für virtuelle und augmentierte Realität
VR- und AR-Technologien machen BIM-Daten auch jenseits von Desktop-Workstations zugänglich. Die virtuelle Realität ermöglicht es den Beteiligten, das Gebäude während der Planung in vollem Umfang zu besichtigen und räumliche Probleme zu erkennen, die in 2D-Zeichnungen und 3D-Desktop-Ansichten nicht sichtbar sind. Die Kunden erleben die vorgeschlagenen Räume vor dem Bau und können so fundierte Entscheidungen über Grundrisse und Ausstattungen treffen.
Augmented Reality überlagert BIM-Informationen auf physischen Baustellen über Tablets oder Smart Glasses. Die Arbeiter können Installationsanweisungen, eingebettete Versorgungseinrichtungen und Montagesequenzen sehen, die den tatsächlichen Gebäudekomponenten überlagert sind. Diese visuelle Anleitung reduziert Fehler, beschleunigt die Einarbeitung und stellt sicher, dass die Arbeit der Planung entspricht. AR unterstützt auch die Qualitätskontrolle, indem es den Ist-Zustand in Echtzeit mit dem Modell vergleicht, so dass Abweichungen sofort und nicht erst bei der Endabnahme festgestellt werden können.
Automatisierte Einhaltung von Vorschriften und Genehmigungen
Aufsichtsbehörden akzeptieren zunehmend digitale Planeinreichungen und eine automatisierte Überprüfung der Vorschriften, wodurch Genehmigungsverfahren, die traditionell wochenlange manuelle Überprüfungen erfordern, rationalisiert werden. BIM-Modelle, die direkt bei den Bauämtern eingereicht werden, werden automatisch auf ihre Übereinstimmung mit den Vorschriften der jeweiligen Gerichtsbarkeit überprüft, was innerhalb von Stunden zur Genehmigung oder zu Ausnahmeberichten führt.
Dieser Wandel erfordert eine standardisierte Bereitstellung von Informationen und zuverlässige Validierungswerkzeuge, was die Einführung von Spezifikationen wie IDS fördert. Da das Vertrauen in die automatische Überprüfung wächst, experimentieren einige Gerichtsbarkeiten mit Echtzeit-Genehmigungen, bei denen konforme Entwürfe sofort genehmigt werden. Der Trend geht über die Bauvorschriften hinaus und erstreckt sich auch auf die Einhaltung von Energievorschriften, die Überprüfung der Barrierefreiheit und die Umweltverträglichkeitsprüfung, die alle automatisch anhand von Modelldaten validiert werden.
Fazit
Es ist unschwer zu erkennen, dass sich die Einführung von BIM-Workflows auf fast jede Phase des Projekts auswirkt, vom Entwurf über die eigentliche Konstruktion bis hin zur Wartung nach der Fertigstellung des Gebäudes. Die Informationen, die BIM liefert, sind in der Lage, das Modell in vielerlei Hinsicht zu verbessern, so dass der eigentliche Prozess von Anfang bis Ende einfacher und effektiver gesteuert werden kann.
Die wichtigsten Erkenntnisse
- BIM-Workflows integrieren Planung, Bau und Betrieb durch gemeinsam genutzte digitale Modelle, die während des gesamten Projektlebenszyklus als eine einzige Quelle der Wahrheit dienen.
- Die erfolgreiche Einführung von BIM erfordert sowohl eine Ausführungsplanung auf Projektebene als auch eine unternehmensweite Standardisierung von Rollen, Software und Modellierungspraktiken.
- Offene Standards wie IFC, BCF und IDS ermöglichen die Interoperabilität zwischen verschiedenen Softwareplattformen und gewährleisten die langfristige Zugänglichkeit der Daten.
- Durch die frühzeitige Erkennung von Kollisionen und die Modellvalidierung in der Entwurfsphase werden kostspielige Nacharbeiten während der Bauphase vermieden.
- BIM bietet messbare Vorteile, darunter eine um 20 % schnellere Projektabwicklung, eine Kostensenkung von 15 % und 30 % weniger Planungsfehler, wie Branchenuntersuchungen zeigen.
- Neue Technologien wie künstliche Intelligenz, digitale Zwillinge und die automatische Überprüfung der Einhaltung von Vorschriften werden den Wert von BIM in den kommenden Jahren weiter steigern.
Entdecken Sie nahtlose BIM-Kollaboration – fordern Sie noch heute Ihre persönliche Demo an